Entgegen der Versuche von Flink, Flaschenpost, Gorillaz und Co. ist der Supermarkt noch immer der zentrale Ort des alltäglichen Konsums. Meinethalben darf das gern so bleiben – die Vorstellung, dass die Herkunft des Essens noch abstrakter und der nächste soziale Sammelplatz aufgegeben wird, erscheint mir nicht sonderlich attraktiv.
Ob also als Feier des Bestehenden oder schon als Erinnerung an das künftig Verschwundene, seien hier drei Empfehlungen genannt, die den Ort auf Begriffe und Bilder zu bringen versuchen.
David Wagner. Vier Äpfel. Roman 2009
Ein Mann geht durch einen Supermarkt – das ist es mehr oder weniger. Falls sich künftige Historiker:innen und Ethnograph:innen für Konsum in den 2000ern interessieren, werden sie dieses Buch als Quelle nutzen.
Firmiert unter dem Label Literatur, kommt aber äußerst sachlich-beschreibend daher (»Proust-inspired« steht auf der Rückseite). Der Text fühlt sich journalistisch an; es geht um Waren, Architektur, Ethik, Mitkonsument:innen – eben alles, wohin sich das Beobachten und Denken im Medium käuflicher Lebensmittel bewegen kann. Der Raum und seine Bewohner – Produkte wie Menschen – dienen als Auslöser für Erinnerungen und Träume, vor allem an eine verflossene Liebe, die immer wieder im Bewusstsein des Erzählers anklopft.
Den Grundton bildet eine schöne Mischung aus Melancholie und Erstaunen. Punktabzüge gibt es aber für die äußerst scheußliche Covergestaltung.
Auszüge
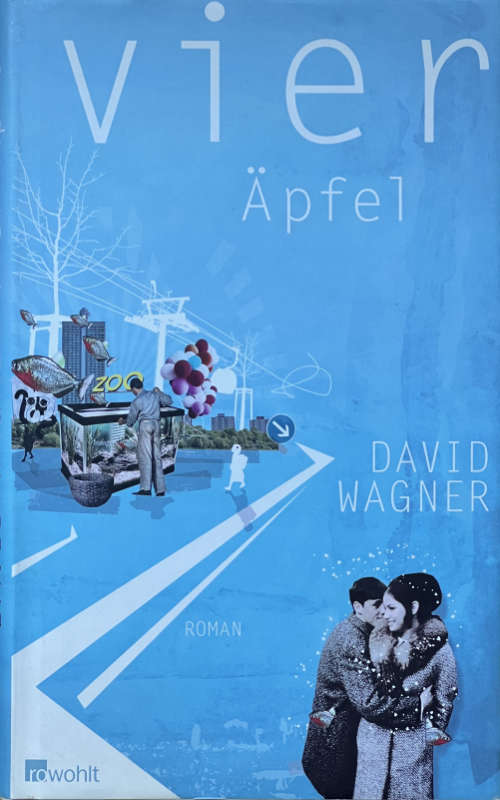
»Wer oder was bestimmt über mich? Ich glaube, ich bin eine Biene, die durch den Supermarktgarten fliegt, die Verpackungen sind meine Blüten, Form und Farben, Schrift und Geruch verführen mich. Geruch? Aber ich rieche doch gar nichts, ist ja alles verpackt. Ich bin dressiert darauf, auf Formen, Farben und Schriften zu reagieren, bin vielleicht kein perfekter, alles in allem jedoch ein zuverlässiger Konsument, denn ich kaufe die Marken, die ich kenne und schätze und schon immer kaufe, und bin mit ihnen glücklicher als mit den Produkten ohne Namen, meine Marken sind noch bei mir, L. ist es nicht.«
»Gehört es zur Konvention des Supermarktverhaltens, so zu tun, als wäre kein anderer da, alle anderen zu übersehen, durch sie hindurchzublicken, gar nicht zu bemerken? Die Strumpfhosenfrau und alle anderen, die gerade hier sind, sind zwar zur selben Zeit im selben Supermarkt, verhalten sich aber so, als hätte jeder von ihnen seine eigene Zeit dabei, die sie wie eine halbtransparente Schutzfolie umhüllt. Ich glaube, diese Folie umhüllt auch mich, auch ich bin eigentlich unnahbar. Ich sehe nur verschwommen und werde selbst, was mir ganz gut gefällt, nur verschwommen gesehen.«
Sayaka Murata. Die Ladenhüterin. Roman 2016
Von der anderen Seite der Theke und aus einem fernen Land, nämlich Japan, berichtet Sayaka Murata in ihrem Roman Die Ladenhüterin. Hier ist der Supermarkt ein so genannter »Konbini«, ein kleineres Geschäft, das z. B. auch Speisen anbietet – ein Laden ähnlich einem Rewe to go, irgendwo zwischen städtischem Supermarkt und Kiosk.
Der Originaltitel lautet Konibini Ningen, und wenn mich die Übersetzungsprogramme nicht täuschen, heißt Ningen Mensch – »Ladenhüterin« ist also ein tendenziöses Wort, das meines Erachtens zu stark interpretiert. Die Übersetzerin spiegelt mit dem Wort das Außenseitertum der Protagonistin Keiko, die – klassisches Motiv – nicht den Erwartungen der Gesellschaft entspricht. Mit dieser Umschrift wird allerdings unterschlagen, dass sie diesen Erwartungen gar nicht entsprechen will. Die Umwelt mag ihr noch so sehr nahelegen, doch zu heiraten und sich einen vernünftigen Beruf zu suchen – Keiko mag einfach nicht mitmachen. Sie ist keineswegs so passiv, wie es der deutsche Titel nahelegt.
Was das Buch interessant macht. Sicher, es lässt sich auch als kapitalistische Entfremdungsgeschichte lesen – die starren, kleinlichen Regeln der Bosse, der Gute-Laune-Zwang, die leeren Rituale an der Kasse, die ewige Wiederholung des Immergleichen, die wahnwitzige Normalität, die sich eine Corporate Governance ausdenkt und den Angestellten reinprügelt. Für Keiko erscheinen aber weniger die Verhältnisse im Konbini, sondern in der Welt als verrückt.
Es geht gewissermaßen um zwei Regelsysteme, die einander gegenübergestellt werden. In beiden gilt es zu funktionieren, und für Keiko klappt das einfach besser im Konbini. Der Raum und seine Regeln sind überschaubarer, sie kann sich an Dinge und Routinen halten, die ihren Alltag strukturieren.
Das erscheint dem kapitalismuskritischen Blick, nicht überraschend, als falsch und entfremdet. Murata aber aber vielmehr eine Art Doublette, denn die vermeintlich nicht-ökonomische Welt »da draußen« ist genauso von Regeln – governance – durchdrungen wie das Leben als Supermarkt-Angestellte. Naoise Dolan beschreibt das so: »It’s easy to see Keiko as a late-capitalist stooge, but I don’t read Convenience Store Woman as an interrogation of alienated labour. To me, the novel says that if one play-acts everywhere, it’s freeing to have a script. I’d never seen that in fiction: no schmaltzy girl-boss pipe dreams, just bald awareness that all human integration requires pretence if society finds you weird. I loved Keiko. She got it.«
Mir gefällt besonders das wiederkehrende Motiv des Klangs, der den Raum des Ladens mit den Körpern verwebt. Die Protagonistin ist in engstem Sinne ein Resonanzkörper, der auf die Signale von Vorgesetzten, Dingen und Kund:innen reagiert und diese Turbulenzen im System Konbini verarbeitet. In diesem Eingebettet-Sein, dem Mitschwingen in einer größeren Struktur und ihren Routinen findet sie bei allen Schwierigkeiten ein Glück.
Auszug

»Endlich war der Tag der Eröffnung da, ich traf bereits am Morgen im Smilemart ein. In den weißen, einstmals leeren Regalen reihten sich dicht an dicht die verschiedensten Artikel. Diese durch unsere Hände entstandene Lückenlosigkeit hatte etwas Kunstvolles. Als ein Mitarbeiter die Türen des neuen Konbini zum ersten Mal für die Kundschaft öffnete, spürte ich, dass jetzt die »Wirklichkeit« begann. Die Kunden waren nicht fiktiv wie bei der Schulung, sondern »echt« und ganz verschieden. Ich hatte gedacht, in einem Büroviertel wie diesem würden nahezu alle Kunden Anzüge oder Uniformen tragen, aber die ersten waren normal gekleidet und hatten meist Gutscheine für Eröffnungsangebote dabei. Sprachlos vor Erstaunen beobachtete ich, wie sie hereinströmten. Als Erste betrat eine ältere Dame mit Stock das Geschält.
›Frau Furukura, wo bleibt die Begrüßung?‹, ermahnte mich der Chef, und ich kam wieder zu mir.
Vor den echten Kunden klang meine Stimme auf einmal ganz anders.
›Guten Morgen! Herzlich willkommen zu unserer Eröffnung! Was kann ich für Sie tun?‹
Außerdem hatte ich nicht erwartet, dass die Spezies ›Kunde‹ derartig viele Geräusche von sich geben würde. Eilige Schritte, Stimmen, das Rascheln der Süßigkeitentüten, wenn sie in den Korb gelegt wurden, oder das Öffnen der Türen zu den Kühlschränken mit den Getränken. Auch wenn der Lärm mich fast erdrückte, schmetterte ich den Kunden unverdrossen meinen Willkommensgruß entgegen.«
Heinz Drügh. Ästhetik des Supermarkts. 2015
Zu guter Letzt sei ein Hinweis auf eine kulturwissenschaftliche Perspektive erwähnt – wobei, wie Heinz Drügh selbst schreibt, schon David Wagners o.g. Roman problemlos als eine solche durchgehen kann.
Damit wird zugleich eine kleine strukturelle Schwäche dieser Studie sichtbar. Oft verdoppelt sie in ihrer Lektüre das, was literarische, filmische, musikalische und andere Werke über Supermarkt und Konsum zum Besten geben, selten geht es über deren Intelligenz hinaus. Drügh hat keine starken Thesen, sondern fertigt Umschriften und Interpretationen an. Es macht ihm offensichtlich Freude, sich mit dem Thema anhand der Produkte anderer zu beschäftigen, und das ist doch eine gute Sache.
Ich selbst hätte mir noch mehr marktnahe Analysen wie die zur „Supergeil“-Kampagne von Edeka gewünscht. Stattdessen stehen eher die Künste im Mittelpunkt – also Ästhetik, die sich mit dem Supermarkt beschäftigt statt jene, die dieser selbst aufzieht. Als Überblick durch eine poplastige Kulturgeschichte ist das selten total überraschend, aber meist unterhaltsam: Cormac McCarthy, The Walking Dead, Andreas Gursky, Richard Hamilton, Pulp, Andy Warhol, bis zu Lil’ Wanye, Iggy Pop, uvm. – ein ordentliches Sammelsurium, das gute Linien zieht.
Der Text folgt in seinem Streifzug der mittlerweile etablierten akademischen Geste, derzufolge man nicht mehr einfach nur kritisiert, sondern die gesellschaftliche Relevanz eines anscheinend niederen Themas angemessen würdigt. Eine doppelte Bewegung, die sich nicht mit ihrem Gegenstand – kapitalistische Interessen, Sophistication der Werbung, besinnungsloser Konsum – gemein machen, aber dennoch eine Art verkniffene Anerkennung für diesen artikuliert: »Worum es aber hier geht, ist, trotz all dieser Kritik nicht zu übersehen, wie sehr Waren, ihre Bilder und ihr Konsum eine kulturbildende, -ordnende und -interpretierende Funktion besitzen.«
Sätze wie diese wirken auch diesseits wissenschaftlicher Sprachspiele einigermaßen gespreizt. Davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen. Angesichts des akademischen Dünkels gegenüber einem Thema wie Konsum1 sind sie offenbar noch immer notwendig, damit Texte wie dieser sich legitimieren und also geschrieben werden können.
Im Konkreten macht er dann auch oft genug Spaß – man kann bestens in dem Buch rumblättern.
Auszug
»Geprägt wird die Bezeichnung ›supermarket‹ in den USA der 1930er Jahre. Auch wenn die genauen Ursprünge nicht ganz geklärt sind, wird vermutet, dass »Hollywood associations« hinter dem Neologismus stecken: »super being a new word at the time coined by film promoters on the same lines as ›colossal‹ or ›stupendous‹.« (Bowlby 2000, 138). Supermärkte sind aber der gängigen Auffassung nach nicht wirklich ›super‹ im Sinne von glamourös, sie sind vielmehr einfach nur groß. Das Supermarkt-Prinzip ›pile it high and sell it cheap‹, d.h. hoher Absatz bei geringer Gewinnmarge, niedrige Preise, Schnäppchenjagd, Selbstbedienung, großer Parkplatz, das in den USA nicht zuletzt aufgrund der Wirtschaftskrise zum Erfolgsmodell wurde, fand seinen Ort zunächst in ›shabby barns‹ (Zimmerman 1941, 407).«
